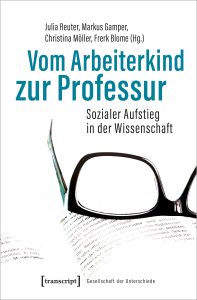 Universitäten seien «eine der letzten feudalistisch geprägten männerbündlerischen Bastionen unserer Gesellschaft». Einrichtungen also, die bestimmte Menschen bevorzugen und andere, eher unangepasste, ausschließen würden. Was die 1954 geborene Erziehungswissenschaftlerin und Geschlechterforscherin Elke Kleinau hier beschreibt, bezieht sie wohl in erster Linie auf das soziale Geschlecht. Genauso könnte es aber auf die soziale Herkunft bezogen werden.
Universitäten seien «eine der letzten feudalistisch geprägten männerbündlerischen Bastionen unserer Gesellschaft». Einrichtungen also, die bestimmte Menschen bevorzugen und andere, eher unangepasste, ausschließen würden. Was die 1954 geborene Erziehungswissenschaftlerin und Geschlechterforscherin Elke Kleinau hier beschreibt, bezieht sie wohl in erster Linie auf das soziale Geschlecht. Genauso könnte es aber auf die soziale Herkunft bezogen werden.
Die Zahlen des Bildungstrichters sind bekannt. So ist die Akademikerrate an der Erwerbsbevölkerung gar nicht so hoch wie viele immer denken, sie betrug 2017 z.B. (nur) 22 Prozent (S. 14). Gleichzeitig kommen aber über 52 Prozent aller Studierenden aus Akademikerhaushalten. Es gibt für Angehörige aus Haushalten der Armuts- und ArbeiterInnenklasse also eine objektive Ungleichheit im Zugang zu Hochschulen einerseits und ebenso zum Arbeitsmarkt an Universitäten und in der Wissenschaft andererseits. Gleichzeitig ist die Zahl der Studierenden regelrecht explodiert. Studierten 1960 sechs Prozent eines Jahrgangs, sind es heute 56 Prozent (S. 12).
Der hier vorliegende Band diskutiert die Themen Ungleichheit und soziale Herkunft in seiner ausführlichen Einleitung (S. 9 bis 63) und in fünf Beiträgen, u.a. von Michael Hartmann, Andrea Lange-Vester und Aladin El-Mafaalani, aus. Hier geht es immer wieder um die verschiedenen institutionellen, wenn nicht diskriminierenden Barrieren im Hochschul- und Wissenschaftsbereich, die dazu führen, dass Chancengleichheit schlichtweg eine Illusion ist.
Kern des Buches sind aber im Jahr 2019 verfasste, autobiographische Texte von 12 Männern und sieben Frauen. Es fällt eine generationelle Spaltung der Beitragenden auf, die Hälfte ist z.B. bereits im Ruhestand (das sind die neun Personen bis Jahrgang 1955). Weitere neun sind dann zwischen 1958 und 1970, und die jüngste 1983 geboren. Sie berichten über ihre Herkunft, ihre Bildungsbiographie und prägende Erlebnisse an Hochschulen. Rückblickend lässt sich feststellen, dass es, in der Selbstauskunft, vor allem nicht-ökonomische Motive waren, die den Weg in die Wissenschaft wiesen. Teilweise verfallen die Erzählenden – auch – dem «Mythos des Aufstiegs» und vor allem des Glücks in ihren Berichten. Der Begriff «Aufstieg» wird im Buch oft verwendet; in der Klassismusdiskussion wird er von vielen Aktiven mittlerweile vermieden, da er implizite Wertungen enthält, stattdessen wird dann von Milieu- oder Klassenreise oder Klassenübergang gesprochen.
Irgendwie scheinen die Autor*innen in ihrer Bildungsreise meist eher wenig Mühe gehabt zu haben, vor allem die Gruppe der älteren. Sabine Hark, Jahrgang 1962, schreibt, sie sei ja die Generation der auf dem Dorf geborenen Student*innen der Ära Willy Brandt, also diejenige, die von der Bildungsexpansion und der Massenuniversität der 1970er profitiert habe. Ja, ihre Karriere und die vieler anderer sind so vermutlich nicht mehr möglich (S. 388). Die zwangsprekarisierten wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen von heute sind mehrheitlich später als 1980 geboren, die derzeitigen Studierenden um die Jahrtausendwende. Ihnen dürften manche Berichte aus dem Buch und die dort beschriebenen Freiräume und Strukturen wie welche von einem anderen Planeten vorkommen.
Insgesamt ist das Buch in seinen persönlichen Berichten und seinen akademischen Artikeln ein wichtiger Beitrag zum Komplex «Macht und Diskriminierung an Hochschulen» und auch, trotz einiger Schwächen, einer zur Debatte um Klassismus in der Wissenschaft, auch wenn nur Mitherausgeberin Julia Reuter den Begriff überhaupt verwendet (S. 119/120).
Julia Reuter, Markus Gamper, Christina Möller, Frerk Blome (Hg.): Vom Arbeiterkind zur Professur. Sozialer Aufstieg in der Wissenschaft, Bielefeld 2020, 434 Seiten, 28 Euro
Diese Rezension erschien zuerst in Forum Wissenschaft Heft 4/2020, das den Schwerpunkt «Klassismus» hat (mehr Information).



